D.2. BEGRIFFE UND SACHEN KLÄREN:
GESTEINE, MINERALIEN, KRISTALLE
Mit der in der Überschrift genannten Begrifflichkeit wird
ein angehender Sammler konfrontiert, wenn er das erste Mal eine Fundstelle aufsucht bzw.
mit anderen Personen über seine Funde sprechen möchte. Wie in jedem anderen Gebiet gibt
es auch für das Sammeln von Mineralien eine feste Terminologie, die aus den
Geowissenschaften bzw. der Mineralogie i.e.S.
entnommen ist. Die Begriffe helfen bei der Verständigung, indem sie genau definierte
Sachverhalte bezeichnen.
Am Anfang steht wie immer die Beobachtung. Bei den
allermeisten Steinen (um von dem umgangssprachlichen Begriff auszugehen), die man auf den
Fundstellen in die Hand nimmt, kann schon mit bloßem Auge und noch mehr mit Hilfe einer
Lupe erkannt werden, dass sie aus zahlreichen Bestandteilen
bestehen. Voraussetzung ist allerdings oft, dass sie mit dem Hammer
aufgeschlagen werden und man frische Bruchstellen sehen kann.
Bei diesen Bestandteilen handelt es sich um Minerale. Bei dem
abgebildeten Granit sind das Feldspat, Quarz und Glimmer. Das ist nicht der Fall bei dem
abgebildeten Quarzit, der nur aus einem Mineral, nämlich SiO2
besteht. Eine Definition von Gestein muss also unterschiedlichen Sachverhalten gerecht
werden. Die Unterscheidung von „Gestein“
und „Mineral“ kann folgendermaßen getroffen werden:
„Gesteine sind Mineralaggregate“[1]
oder genauer: „Gesteine sind monomineralische oder polymineralische Aggregate von
Mineralen, die selbständige, in sich wesensgleiche Teile der Erdkruste darstellen“[2]
Sprachlich einfacher ist die Definition von W.Schumann:
„Ein Gestein ist ein natürliches Gemenge von mehreren
Mineralarten oder auch aus einer einzigen Mineralart bestehend. Es bildet selbständige
geologische Körper von größerer Ausdehnung[3]“.
„Minerale sind stofflich einheitliche (homogene), feste
anorganische, meist natürlich vorkommende Körper der Erdkruste[4]“
„Die in der Natur vorkommenden chemischen Substanzen
heißen – sofern sie bei Temperaturen unserer Umwelt fest sind – Minerale“[5].
bloßer Überzug oder als Kristall auftreten.
Derb heißt, dass ein Material zwar auch kristallin und der
chemischen Zusammensetzung nach einheitlich ist. Gleichwohl konnten die Kristalle nicht
ihre Eigengestalt aufbauen, weil sie z.B. beim Auskristallisieren aus Platzgründen sich
mit „ihren Nachbarn arrangieren“ mussten[6].
Das Material besteht aus kleinen Kristallkörnern, die so eng miteinander verwachsen sind,
dass sich keine geometrischen Kristallformen ausbilden konnten.
Von Überzug ist dann die Rede, wenn z.B. eine Flüssigkeit,
in der die chemischen Substanzen eines Minerals gelöst sind, über das Muttergestein
geflossen und dann auf dem Gestein getrocknet ist.
Ein Mineraliensammler ist vor allem an Kristallen
interessiert, sie machen den ästhetischen Reiz
der Minerale aus. Für den Formenreichtum der Kristalle (und die Vielzahl der Farben) im
Folgenden einige Beispiele:
Quarz. Stbr. Rohdenhaus/Wülfrath.
Spessartin. Sammlung H.Tepel
Foto: F.Höhle
Cerussit. Grüne Hoffnung Burbach
Kakoxen. Grube Mark Essershausen
Dufrenit. Grube Mark. Sammlung K.Arnold
Fluorit. Sammlung H.Büttner
Pyromorphit. Grube Emilie Altweilnau
Rosasit.
Stbr.Rohdenhaus/Wülfrath Foto:
F.Höhle
Natrolith. Stbr. Ortenberg
Strengit. Grube Rotläufchen
Waldgirmes
Der Begriff „Kristall“ kommt aus dem Griechischen.
Kristallos heißt „Eis“, meint also den festen Aggregatzustand des Wassers.
Zunächst wurde das Wort auf die Bezeichnung einer speziellen Mineralart, den
Bergkristall, eingeschränkt. In der modernen Naturwissenschaft geht man von der atomaren
Kristallstruktur aus.
W.Lieber gibt eine Definition von „Kristall“ in
Abgrenzung von „Gestein“:
„Ein Gestein weist eine willkürliche Begrenzung auf.
Ein Mineral kann aber bei unbehindertem Wachstum geometrische Körper mit Ecken, geraden
Kanten und ebenen Flächen bilden. Ein Kristall ist ein fester Körper, dessen Bausteine
dreidimensional periodisch nach Art eines Raumgitters angeordnet sind.[7]
Der letzte Aspekt verweist auf den atomaren Bau der
Kristalle, direkt angesprochen in der folgenden Definition:
„Kristalle sind 3-dimensional periodisch aus Ionen,
Atomen oder Molekülen aufgebaute homogene Festkörper“[8].
Den periodischen Aufbau
der Kristalle, die Kristallstruktur, haben wir uns so vorzustellen, dass man wie bei einer Tapete oder einem Netz immer wieder
auf die gleichen Muster trifft, wenn man in eine Richtung vorgeht.
Was hier auf einer Ebene, also zweidimensional, geschieht,
gilt für das Raumgitter eines Kristalls dreidimensional im Raum.
Sammler, die in magmatischen Gesteinen nach Mineralien
suchen, stoßen häufig auf glasartige Einsprengsel in Gesteinshohlräumen. Ihnen fehlen
die Formen der Kristalle. Dafür verantwortlich sind die schnelle Abkühlung und
Erstarrung der Gesteinsschmelze, die die Bildung von Kristallen verhindert haben. Man
spricht in diesen Fällen von natürlichem vulkanischem Glas, das wie unser künstliches
Glas amorph ist, eben weil Kristalle fehlen.
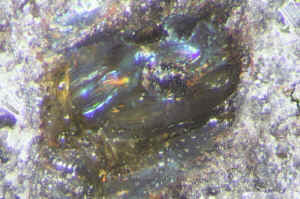
Vulkanisches Glas; Stbr. Bellerberg Ettringen
Zu den Gläsern gehört auch der kulturgeschichtlich wichtige
Obsidian, aus dem die Steinzeitmenschen Pfeilspitzen und Messer hergestellt haben.
Im Allgemeinen erfolgt der Übergang von einer
Gesteinsschmelze, einer wässrigen Lösung oder einem Gas in den festen Aggregatzustand
direkt. Doch es gibt auch einen Zwischenzustand, der als Gel bezeichnet wird. Es handelt
sich um eine zunächst sehr wasserreiche Substanz, die bei Wasserabgabe hart wird. Daraus
entstehen stalaktitische, nierigtraubige und kugelige Aggregate.
Gelbildung kommt vor, wenn Silikatgesteine von heißen
Wässern zersetzt werden. Hierbei entsteht der von Sammlern gesuchte Opal. Ebenfalls als
Gel ausgeschieden werden die Glasköpfe aus Rot- und Brauneisenstein. Durch nachträgliche
Kristallisation erhalten sie das im Anschnitt der Kugeln sichtbare radialstrahlige
Gefüge.

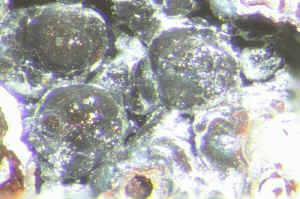
Hyalit. Feld Falkenstein Waldgirmes
Goethit-Glaskopf, Schöne Aussicht Dernbach
[1]
Rothe, P., Gesteine. Entstehung – Zerstörung – Umbildung. Darmstadt 1994 S.43
[2] ebenda S.5
[3] Schumann, W., Das
Buch der Erde. Bd.1 München 1987 S.108
[4] Rothe,P. a.a.O.
S.5
[5] Nickel,E.,
Grundwissen in Mineralogie. Teil 1: Grundkurs. Thun 1995 S.15
[6] Wimmenauer, W.,
Zwischen Feuer und Wasser. Gestalten und Prozesse im Mineralreich. Stuttgart 1992 S.
[7] Lieber,W., Der
Mineraliensammler. Über den Aufbau von Sammlungen und was man dazu wissen sollte.
Thun, München 1968 S.15
[8]
Borchardt,R./Turowski,S., Symmetrielehre der Kristallographie. München, Wien 1999 S.2
